|
|
Duodonisvillare
|

|
|
(Weiler
des Dudo)
|
oder richtiger: "Die Kapelle in Duodonisvillare" wurde
von Kaiser Otto II. in einer Urkunde genannt, in der er dem Nonnenkloster St.
Peter in Metz im Jahre 977 seinen Besitz bestätigte. Dieses Datum ist deshalb,
weil es die erste urkundliche Erwähnung des Ortes ist, quasi die Geburtsstunde
von Dudweiler, das also folglich im Jahre 1977 bereits seine Tausendjahrfeier
beging.
Wann aber in Wahrheit die Besiedlung unseres Ortes, der im Tal des
Sulzbachs, einem rechtsseitigen Zufluss der Saar, zwischen der Landeshauptstadt
Saarbrücken und der Stadt Sulzbach gelegen ist, beginnt, vermag niemand mit
Bestimmtheit zu sagen. Die an den unterschiedlichsten Stellen im Stadtgebiet
ausgegrabenen Artefakte (Steinbeile, Faustkeile, Pfeilspitzen) lassen aber
darauf schließen, dass hier bereits in der Steinzeit Besiedlung stattfand. Auch
in der Bronze- und Eisenzeit durchzogen wandernde Völkerschaften unsere Heimat.
Sicher ist aber, dass seit fünf Jahrhunderten vor der Zeitenwende Kelten im
Sulzbachtal siedelten. Zwei Grabhügel in der Nähe des
"Dreibannsteins", der die Gemarkungsgrenzen zwischen Saarbrücken,
Scheidt und Dudweiler anzeigt, sind Zeugnisse keltischen Lebens. Auch die Römerzeit
ging nicht spurlos an Dudweiler vorüber. Reste eines römischen Tempels, römische
Hohlleisten-Ziegel und eine Säule aus Sandstein mit Kapitell und Rundstab
wurden bei der Abteufung eines Brunnens 1896 auf dem "Alten Büchel"
gefunden. Die heutige Autobahn A 623, frühere Bundesstraße 41 - die "Grühlingsstraße"
- war ursprünglich eine alte römische Heerstraße. Der römische Einfluss
schwand unter der Völkerwanderung. Ruhelose fremde Völker brachten, Zerstörung,
Not und Leid über die Bevölkerung.
|
Die Franken mögen wohl Gefallen an dem Fleckchen Erde gefunden
haben, das sich ihnen hier, waldreich und fruchtbar, zur Besiedlung anbot.
Ein fränkischer Edelmann und seine Getreuen blieben hier. Dudo ahnte wohl
nicht, dass sich der von ihm geschaffene, nur aus vereinzelten Gehöften
bestehende Weiler im Laufe von tausend Jahren zu einer respektablen Wohn-
und Industriestadt entwickeln, und noch heute seinen Namen tragen würde.
Wahrscheinlich aber noch zu seinen Lebzeiten wurde dann von Kaiser Otto II
sein Weiler "Duodonisvillare" urkundlich erwähnt.
|
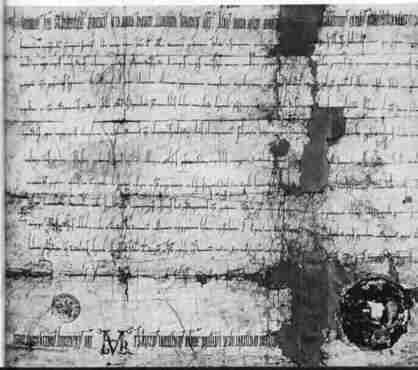
Die Besitzurkunde
des Klosters St. Peter, Metz,
ausgefertigt durch Kaiser Otto II.
|
|
|
Kirchen- und
Wahlbestätigung Kaiser Otto II. für St Peter
zu Metz vom 11. Mai 977 aus Diedenhofen.
Im Namen der heiligen
und ungeteilten Dreieinigkeit!
Otto, durch die begünstigende göttliche Milde Kaiser und Augustus
Wenn Wir den Stätten,
die sich dem göttlichen Kult widmen, etwas übergeben,
wissen Wir, dass dies uns zweifellos zur Erlangung der ewigen Seligkeit
nützt.
Deshalb soll die
Gesamtheit aller gegenwärtigen und zukünftigen Kirchengläubigen zur
Kenntnis
nehmen, dass eine gewisse ehrwürdige Gottesverehrerin, die Äbtissin
Helwidis,
die jetzt bekanntlich das Kloster innerhalb der Metzer Stadtmauern,
das zu Ehren der Apostelfürsten errichtet und seit früher Zeit
Altmünster genannt wurde,
unter ihrer Leitung hat, uns eine vollzogene Urkunde unseres Vaters
seligen Angedenkens
des Kaisers und Augustus über die Gesamtheit der Kirchen und Besitzungen
vorlegte,
die zu jener Abtei gehören.
Da Unruhen aufgetreten
und von jenen Kirchen einige durch Gewalt der Nutznießung
durch diese Abtei entzogen worden sind, bat sie demütig,
dass Wir durch unsere Urkunde jene Kirchen den Nonnen, die dort das
Klosterleben führen,
wieder zu ihrer Pfründe zurücktun und durch die Rückerlangung
bestätigen.
Wegen der Fürsprache
Unserer geliebten Gemahlin und gleichermaßen
Kaiserin Theophanu,
des Ortsbischofs Theoderich und des Herzog Friedrich sowie im Blick auf
ewigen Lohn
und mit dem Ziel, dass die genannten Jungfrauen für Gott dort
getreulicher und geregelter streiten
können, haben Wir der Bitte der Äbtissin zugestimmt.
Wir
haben wiedererlangt und der Nutzung durch die Nonnen vollständig durch
Übertragung
zurückerstattet alle Kirchen dieser Abtei, die in folgenden Orten liegen:
In
Seutry, Colligny, Manonville, Maidières, in Saint-Quentin-Berg,
Malstatt mit der Kapelle von Dudweiler, in St. Petersberg, in Bazoncourt,
Lesse mit der Kapelle Arraincourt, Heßdorf, Thalange, Bouxières-aux
Chenes,
Vandieres mit der Kapelle des Weilers Preny, Bayonville-sur-Mad,
Vandellainville,
Sorolfi villa und Weimeringen.
Wir
haben befohlen, diese Urkunde über unsere Rückerstattung zu schreiben.
Durch sie geben Wir Unserem Willen Ausdruck und ordnen bestimmt an,
dass die erwähnte Äbtissin und ihre Nonnen für alle Folgezeit diese
Kirchen unmittelbar
vom heutigen Tage an zum gemeinsamen Nutzen auf ewig in Besitz haben.
Und da die erwähnten Nonnen seit den Zeiten König Theuderichs eine
Urkunde
über das Vorrecht der eigenen Wahl haben, räumen Wir ihnen das Recht
ein, die Äbtissin gemäß
Gottesfurcht und Klosterregel zu wählen, ebenso bei Bedarf den
Vogt.
Damit
diese Urkunde in allem besondere Kraft hat,
haben Wir sie mit eigener Hand vollzogen und mit dem Aufdruck Unseres
Siegels
zu kennzeichnen befohlen.
Ich,
Kanzler Egbert, habe in Vertretung des Erzkappellans Willigis
gegengezeichnet.
Gegeben
am 11. Mai im Jahre 977 der Fleischwerdung des Herrn in der 6. Indiktion
im 16. Königs- und im 10. Kaiserjahr des Herrn Otto.
Verhandelt
in Diedenhofen
|
Und
hier die Übersetzung der in lateinischer Sprache verfassten Urkunde
|
|

|
Über die Jahrhunderte hinweg, bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen
Krieges, war die Einwohnerzahl wohl um die 150 bis 250 Menschen (Das älteste
bekannte Einwohnerverzeichnis - aus dem Jahre 1542 - bezeugt in Dudweiler
23 Haushalte und 13 Dienstleute, was einer
Einwohnerzahl von etwa 150 entspricht). Aber dann haben Krieg und
Brandschatzung, Grauen und Tod gewütet und die Einwohnerschaft dezimiert.
Nebenstehendes
Bild:
Der "Alte Turm" im Hof der "Turmschule"
Ältestes Bauwerk in Dudweiler ist der aus dem 14. Jahrhundert
stammende alte Kirchturm. Das dazugehörende Kirchenschiff musste 1907 dem
Schulhausneubau weichen. Seit 1910 steht er unter Denkmalschutz.
|
|
|
|
Nach und nach gewann die im Saarbecken und auch im Sulzbachtal
reichlich vorhandene Kohle an Bedeutung. Zwei Alaunwerke waren in Dudweiler
entstanden. Jährlich lieferten diese über 600 Zentner Alaun, eine
unentbehrliche Grundlage für die Herstellung von Farben (Wäscheblau) und
Salmiak (dazu hier
mehr). Auch ein Sudhaus zur Salzgewinnung aus dem Wasser des Sulzbachs wurde
errichtet. Leider erwies sich aber dann der Salzgehalt des Sulzbachs als zu
gering und bald schon gehörte die Salzindustrie der Vergangenheit an. Nur der
Name der "Sudstraße" erinnert noch daran, dass hier einmal ein
Salzwerk gestanden hat.
Nicht so war es mit der Kohle. Der Leiter des Bergamtes schrieb
schon 1769: "Der Dudweiler Bann ist unstreitig die gesegnetste Gegend des
Landes an Steinkohle!" Schon damals war Dudweiler der Sitz der obersten
Bergbehörde, des fürstlich Nassau-Saarbrücker Bergamtes.
|
Selbst Johann Wolfgang von Goethe lässt es sich nicht nehmen, in
seinem Werk "Dichtung und Wahrheit, Buch 10" im Bericht über
seine Reise vom Elsaß nach Saarbrücken
(1770), über
Dudweiler, das damals wegen seiner reichen Kohlevorkommen zu einiger Berühmtheit
gelangt war, und seinen "Brennenden Berg" zu berichten.
Der "Brennende Berg" - auch heute noch eine Attraktion
- ist ein innerirdisch brennendes Kohlenflöz. Noch vor vierzig, fünfzig
Jahren waren die aus den Spalten dringenden Dämpfe siedend heiß - so heiß,
dass wir noch als Schulkinder bei Ausflügen mitgebrachte Eier darin
kochen konnten. Auch heute noch steigen aus den Felsspalten warme Dämpfe
auf, die nach Regentagen besonders gut zu sehen sind.
Mehr
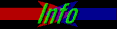 über
den Goethe-Besuch über
den Goethe-Besuch
|

Der "Brennende
Berg"
Mehr
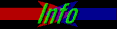 über
den über
den
Brennenden Berg
|
|
|
|
|
|
|
|
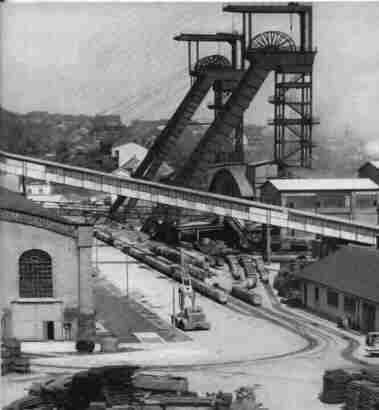
Grube Jägersfreude
|
Im 19. Jahrhundert wächst Dudweiler dann zu einem Ort
beachtlichen Ausmaßes heran. Die Kohlengruben (in der Glanzzeit vier an
der Zahl) mit ihren unerschöpflich scheinenden Vorkommen bringen
Bergarbeiter aus weit entlegenen Gegenden heran. Sie kommen aus dem
Hochwald, dem Hunsrück und der Eifel, nicht selten zu Fuß, graben hier
nach Kohle, während ihre Frauen zu Hause sich um Haus und Hof kümmern.
Des ewigen Wanderns zwischen Arbeitsstätte und Familie müde, bleiben sie
eines Tages in Dudweiler, erwerben ein Stück Land, bauen sich ein Haus
und finden so hier ihre neue Heimat.
(Siehe hierzu auch meine Bemerkungen über die Geschichte des
Saarlandes in den letzten 200 Jahren - hier)
|
Im Gefolge des Kohleabbaus gründen sich Eisenwerke,
Maschinenfabriken, Stahl- und Apparatebau. Elektrotechnische Geräte, Präzisionswerkzeugteile,
Leuchtröhren und Feuerlöschgeräte gehen von Dudweiler zum in- und ausländischen
Markt. Handel, Handwerk und Gastronomie (die weithin berühmte "Dudwillerer"
Gastfreundlichkeit!) nehmen eine besondere Stellung im Gemeindeleben ein.
Nach dem zweiten Weltkrieg, zu Beginn der 60iger Jahre, mit damals
um die 29.000 Einwohnern, ist die Gemeinde lange Zeit weithin als "das größte
Dorf Europas" bekannt. Am 12. September 1962 ist es dann so weit: Dudweiler
werden die Stadtrechte verliehen!
|
Leider aber währte diese Episode der Geschichte Dudweilers nicht
sehr lange. Obwohl die Dudweilerer Bevölkerung sich in mehreren
Abstimmungen und mit einem Demonstrationszug, der als "Marsch auf
Saarbrücken" bekannt wurde, vehement dagegen zur Wehr setzte, wurde
die selbständige Stadt Dudweiler im Zuge der saarländischen Gebiets- und
Verwaltungsreform im Jahre 1974 der somit entstehenden "Großstadt"
Saarbrücken eingemeindet.
Als "Trostpflästerchen" erhielt der
nun entstandene "Stadtbezirk Dudweiler" innerhalb der Verwaltung
einen "Sonderstatus". Er erhielt eine in verschiedenen Bereichen
eigenständige Bezirksverwaltung mit einem hauptamtlichen Bezirksbürgermeister
an der Spitze und mit - eingeschränktem - eigenem Budget-Recht. Ein
eigenes Standesamt (Standesamt Saarbrücken III), eigene Ortspolizeibehörde,
Meldeamt, Passamt, Kfz-Zulassungsstelle, Bezirksbauhof.
Politisches
Gremium ist der Bezirksrat, in dem seit der Kommunalwahl im Juni 1999 die
CDU die stärkste Fraktion ist (vorher: SPD).
Daran haben auch die Kommunalwahlen vom
13.06.2004 nichts geändert. Nach dem Ergebnis dieser Wahl verteilen sich
die Sitze im Bezirksrat Dudweiler wie folgt:
CDU 10, SPD 8, Grüne 2, FDP 1.
Die
neuesten Kommunalwahlen am 07.07.2009 ergaben nun allerdings ein
völlig neues Bild. Erstmals ist die Partei "Die Linke" im
Bezirksrat vertreten. Die CDU hat ihre Mehrheit verloren. Sie ist jetzt
stimmgleich mit der SPD (beide je 6 Sitze). Es folgt "Die Linke"
mit 4 Sitzen, dann FDP (3 Sitze) und Grüne (2 Sitze).
Die
Kommunalwahl vom 25.05.2014 brachte erstmal die neue "Alternative
für Deutschland (AfD)" auch in den Bezirksrat, der somit
folgende Sitzverteilung zeigt:
CDU 7, SPD 7,Grüne 2, FDP 1, Linke 3, AfD 1
Im Frühjahr 2014 aber hob der Saarbrücker Stadtrat mit
Beschluss der Mehrheitsfraktionen den Sonderstatus des Stadtbezitks
Dudweiler auf. Die ehemals selbständige Stadt Dudweiler ist seitdem nur
noch ein "normaler" Stadtbezirk. Es gibt keine Eigenständigkeit
mehr, keinen hauptamtlichen Bezirksbürgermeister (nur noch einen
ehrenamtlichen) kein eigenes Budget-Recht, kein Standesamt, keine eigene
Ortspolizheibehörde, keinen Bezirksbauhof. Alle diese Ämter sind in die
bestehenden Stadtämter in Saarbrücken ei ngegliedert worden. Es gibt
lediglich noch ein Bürgeramt als Servicestelle für das Melde-, Pass-,
Ausweis- und Kfz-Zulassungswesen.
Die
Kommunalwahl vom 26.05.2019 ergab folgendes Ergebnis. für den Bezirksrat:
CDU 30,4 % (6 Sitze); SPD 27,4 % (6); Grüne 19,4 % (4); FDP 8,8
(2); Linke 13,9 % (3). Die AfD ist im neuen Bezirksrat nicht mehr
vertreten.
|

Rathaus Dudweiler
|
|
|
|
|

De Monn midd da long
Stong un sei Kinner
(Der Mann mit der langen Stange und seine Kinder)
|
|
Zu dem obigen Bild sind einige Anmerkungen und Erläuterungen
erforderlich:
Die Straßenbeleuchtung in Dudweiler wurde lange Zeit, bis weit
in die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, mit Gaslaternen betrieben.
Zu diesem Zweck gingen durch die einzelnen Straßen der Gemeinde hierzu
angestellte Gemeindemitarbeiter kurz vor Einbruch der Dunkelheit mit einer
langen Stange, die am Ende mit einem Widerhaken versehen war, von Laterne
zu Laterne und zündeten deren Flamme, indem sie über einen oben am
Lampenkörper angebrachten Hebelzug die Gasversorgung zur Laterne öffneten.
In seiner Rede zur 1000-Jahr-Feier Dudweilers, am 1. Juli 1977
nahm der bekannte saarländische Schriftsteller Ludwig Harig, der eine
zeitlang selbst in Dudweiler wohnte, diesen "Monn midd da long Stong"
als Urbild des "Dudwillerer Grammetschlers". Harig schildert in
seiner launigen Festansprache den Dudweilerer als selbstbewussten
Menschen, der, manchmal etwas grantig ("Grammetschler"), aber
stets am Kern der Sache bleibend, "denne do owwe (der
Landesregierung)" und erst recht den "Molschdern (Der
Rathausmannschaft in Saarbrücken)" zeigt, was eine Harke ist.
Besonders bezug nehmend auf die Ereignisse, vor und auch noch während der
Gebietsreform von 1974 (s. oben) sagt Harig: "Und so sitzt nun unser
Dudo (s. oben) auf dem Alten Büchel (ältestes Dudweiler Siedlungsgebiet)
und droht mit seiner "long Stong" nach Saarbrücken hin, das ihn
so schmählich einkassiert hat, obwohl sein Dudweiler ja um einige Jahre
(22) "älter" ist, als die Landeshauptstadt."
Unter anderem trug diese Rede Harigs mit zur Inspiration des
damaligen Bezirksbürgermeisters Hermann Schon - ein Ur-Dudweilerer -
bei, dem "Monn midd da long Stong" ein Denkmal zu setzen. Mit
Unterstützung des Bezirksrates und des Verkehrsvereins gelang es Hermann
Schon in dem Kesselschmied Zoltan Hencze (+) einen Mann zu finden, der an die
Vollendung des Werkes gehen konnte. In echter Handarbeit schmiedete Hencze
dann an langen Winterabenden das Ensemble zusammen, das ursprünglich nur
aus dem Mann und der Laterne bestand. Es wurde 1989 auf dem Alten Markt in
Dudweiler, auf dem auch jetzt noch dienstags und freitags der gut bestückte
und reich frequentierte Wochenmarkt stattfindet, aufgestellt.
Einige Zeit später kamen dann die beiden Kinder, ebenfalls von
Hencze geschmiedet, hinzu. Diese Ergänzung der Gruppe macht vor allem
dadurch Sinn, weil die Kinder der Umgebung sehr wohl immer mit dem
Gaslaternenanzünder mitliefen, wenn dieser seiner Tätigkeit in ihrer
Wohnstraße nachkam. War sein Erscheinen doch für die Kinder, die zu
jenen Zeiten noch nicht - wie heute - eine Armbanduhr am Arm trugen, das
Zeichen, dass es jetzt Zeit für sie sei, nach Hause zu gehen, wo schon
das Abendessen auf sie wartete. Denn die Mutter (der Vater) hatte ihnen
eingeschärft: "Wann de Monn midd da long Stong kummt unn die Lompe
oonmacht, kummschd de hemm! (Wenn der Mann mit der langen Stange kommt,
und die Laternen anzündet, kommst Du nach Hause!)"
Die Laterne der Gruppe wird heute allerdings (leider?!!?) nicht
mit Gas betrieben, was ja an sich stilgerecht wäre, sondern mit
elektrischem Strom.
Von Hermann Schon stammt übrigens auch die Idee, besonders
verdienstvollen Dudweiler Bürgern bzw. Personen, die sich um Dudweiler
verdient gemacht haben, eine Auszeichnung in Form der "Dudwillerer
Long Stong" zu verleihen. 27 mal wurde die Auszeichnung, die aus
einer 2,50 m langen Stange besteht, die mit den Stadtfarben (blau-weiß)
von Dudweiler geschmückt ist, bisher verliehen. Einer der ersten Preisträger
ist natürlich Ludwig Harig, der ja mit seiner Rede praktisch die Initialzündung
zur "long Stong" lieferte. Und selbstverständlich wurde sie
auch dem verdienstvollen Bezirksbürgermeister Hermann Schon nach seiner
Pensionierung verliehen.
Recht interessant ist auch die auf dem Bild links im Hintergrund
zu sehende Giebelfassade des Kaufhauses "Kaufland". Die dort
angebrachte flächendeckende Holzplastik vermittelt dem Betrachter durch
ihre perspektivische Formgebung den Eindruck, er stehe vor einer überdachten
Passage, in die er hineingehen kann.
Im rechten Hintergrund zeigt das Bild einen Blick in die Saarbrücker
Straße (Einkaufsmeile, heute Fußgängerzone). Darüber der Rathausturm.
|
Website
der Bezirksverwaltung Dudweiler
Zum Seitenanfang
   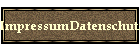

|
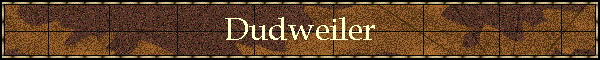 Dudweiler
Dudweiler